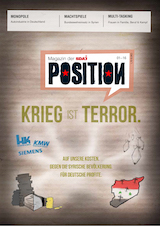Venezuela nach dem Wahlerfolg der Rechten
Die Linke in Venezuela steht vor der vielleicht schwersten Herausforderung seit dem Putschversuch vom 11. April 2002. Bei den Parlamentswahlen am 6. Dezember 2015 konnte das rechte Oppositionslager – der aus rund 20 Parteien bestehende »Tisch der demokratischen Einheit« (MUD) – eine klare Mehrheit in der Nationalversammlung gewinnen. Nach dem vorläufigen Endergebnis des Nationalen Wahlrats verfügt die Rechte mit 112 Abgeordneten über die Zweidrittelmehrheit im Parlament und kann so z.B Verfassungsänderungen initiieren.
Mehrere unterlegene Kandidaten der Vereinten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) haben gegen das Ergebnis der Wahlen Klage eingereicht. Dabei geht es nicht um die Abstimmung und Auszählung selbiger – die wurde von der Regierung um Präsident Nicolás Maduro sofort anerkannt –, sondern um Gesetzesverstöße im Umfeld der Wahlen, etwa Stimmenkauf, Einschüchterung und andere Manipulationsversuche. Insgesamt zehn Klagen nahm der Oberste Gerichtshof Ende Dezember zur Entscheidung an und gab in einem Fall auch dem Antrag auf einstweilige Aussetzung der Mandate statt. Damit sind vier gewählte Abgeordnete aus dem Bundesstaat Amazonas – drei Vertreter der MUD und einer der PSUV – bis zur endgültigen Entscheidung über die Anfechtung suspendiert. Für die Rechten bedeutet das, dass sie zunächst keine Zweidrittelmehrheit mehr haben.
Unmittelbar nach der Konstituierung der Nationalversammlung am 5. Januar zeigte die rechte Parlamentsmehrheit, dass sie auf Krawall gebürstet ist. Der neue Parlamentspräsident Henry Ramos Allup, Chef der SPD-Bruderpartei »Acción Democrática« (AD), vereidigte entgegen der Anordnung der Richter auch die drei suspendierten Abgeordneten der Opposition.
Die reaktionäre Opposition in Venezuela entfesselt also von der Legislative aus einen Kampf gegen die anderen Staatsgewalten – etwa gegen die Exekutive, also gegen die Regierung von Nicolás Maduro, oder auch gegen die Judikative, also die Justiz. Das eigentliche Ziel, das die Rechten nach eigener Aussage innerhalb von sechs Monaten erreichen wollen, ist jedoch der Sturz des Präsidenten und damit die Beendigung des sich seit Anfang 1999 entwickelnden revolutionären Prozesses in Venezuela.
Vorbilder dafür, wie Rechte durch eine Mehrheit im jeweiligen Parlament auch die in Lateinamerika meist direkt gewählte Regierung stürzen können, gab es in den vergangenen Jahren einige. In Honduras und Paraguay gaben Beschlüsse der Abgeordneten das »legale« Deckmäntelchen für den Sturz der demokratisch gewählten Staatschefs ab: Manuel Zelaya 2009 in Honduras und Fernando Lugo 2012.
Wie konnte es dazu kommen, dass sich nun Venezuelas Linke einer solchen Bewährungsprobe gegenübersieht, deren Ausgang offen ist und auch auf der Straße und in den Betrieben entschieden werden wird?
Kampf um die Enttäuschten und Verwirrten
Praktisch seit dem Amtsantritt von Hugo Chávez am 2. Februar 1999 hat die venezolanische Bourgeoisie mit Unterstützung der USA und der EU nichts unversucht gelassen, den Fortschritt aufzuhalten. Dazu gehörten ein Putschversuch 2002 – der innerhalb von 48 Stunden durch einen Volksaufstand vereitelt werden konnte –, die Sabotage der für Venezuela lebenswichtigen Erdölindustrie, gezielte Morde an führenden Politikern und ein unermüdlicher nationaler und internationaler Propagandakrieg. Besonders verschärfte sich die Situation nach dem Tod von Hugo Chávez am 5. März 2013. Sein Nachfolger Nicolás Maduro – zuvor lange Jahre Außenminister – sieht sich seither einem brutalen Wirtschaftskrieg gegenüber. Gezielt verknappen die Besitzer der privaten Handelsketten Waren des Grundbedarfs und sorgen so für Unmut in der Bevölkerung. Hinzu kommen Korruption und Bürokratismus, die diese Probleme weiter verschärfen. Eine wirksame Lösung haben das Kabinett von Maduro und seine Partei, die PSUV, bislang nicht gefunden. Forderungen der mit Maduro verbündeten Kommunistischen Partei Venezuelas (PCV), die Arbeiterklasse zu mobilisieren und so den Kurs der Revolution zu radikalisieren sowie die privaten Handelsketten und Banken zu enteignen, stoßen bei den führenden Kreisen der PSUV bislang auf Ablehnung.
Innerhalb der Regierungspartei und den Institutionen hat sich in den vergangenen Jahren eine Schicht herausgebildet, die sich zwar »revolutionär« und »bolivarisch« nennt, real aber mit ihrer Lage im Hier und Jetzt, vor allem mit ihren Privilegien, durchaus zufrieden ist. Diese »Bolibourgeoisie« hat überhaupt kein Interesse daran, sich selbst den Ast abzusägen, auf dem sie sitzt. Eine Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats, wie sie Chávez gefordert und in vorsichtigen Ansätzen initiiert hatte, steht nicht auf ihrer Agenda. Gerade unter den Parlamentsabgeordneten haben sich in der Vergangenheit viele ein gemütliches Leben gemacht, zumal ein Großteil der Gesetzgebung per Sondervollmachten auf die Regierung übertragen wurde. Das hat auch die Bevölkerung gemerkt, die von den immer gleichen Phrasen genug hat. Deshalb haben viele Menschen, die bei den letzten Präsidentschaftswahlen noch für Chávez und Maduro gestimmt haben, diesmal den Kandidaten der PSUV die Stimme verweigert.
Vor Venezuela stehen nun entscheidende Monate. Noch werden außer dem Parlament alle Staatsgewalten von der Linken kontrolliert, und auch das Militär hat sich bislang zu Recht und Gesetz bekannt und der Regierung Loyalität geschworen. Doch entschieden wird die Zukunft des Landes in den Betrieben, auf der Straße und in den Medien. So haben die linken Gewerkschaften bereits angekündigt, das Arbeitsgesetz zu verteidigen, das ihnen weitreichende Mitbestimmungsrechte (und ein auch für Deutschland beispielhaftes Streikrecht) garantiert – und dessen Abschaffung die Unternehmerverbände schon Stunden nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses von den Rechten verlangt hatten. Auf der Straße und in den Medien wird es darum gehen, den Enttäuschten und Verwirrten klarzumachen, was ihnen droht, wenn die Rechte wieder die volle Kontrolle in Venezuela übernimmt. Diese Auseinandersetzung wird auch international geführt, denn die Mainstream-Medien verbreiten auch hierzulande nur die Positionen der Rechten, während die Regierung als »autoritär« und unfähig verleumdet werden. Dagegen die Stimme zu erheben ist unser Job.
André Scheer, Berlin